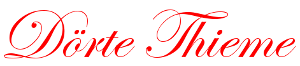Ein letzter Blick in den Spiegel…
Ist der Blick in den Spiegel schon ein Zeichen, dass unser Selbstwert schwächelt? Wozu gibt es denn überhaupt Spiegel, wenn nicht zur Kontrolle und Bestätigung unseres Äußeren? Nicht der Blick selbst, sondern wohl eher die Dauer und die Häufigkeit, wie wir den Spiegel benutzen, geben Auskunft über die Beschaffenheit unseres Selbstwertes. Auf jeden Fall gibt es Situationen, in denen der Blick in den Spiegel einfach unerlässlich ist.
Wer kennt als Frau nicht diesen letzten Moment vor dem Date, wenn die Nerven flattern? Ein nervöser Griff in die Handtasche und schnell noch ein verstohlener Blick in den kleinen Spiegel…..
Im Gegensatz zu uns Frauen bleiben Männer in der Situation ja ziemlich cool – naja, sie tun jedenfalls so.
Aber was soll dieser kurze Blick in den Spiegel eigentlich? Ändern können wir in dem Moment doch eh nichts mehr! Wir wissen, dass der Pony zurzeit verschnitten, die Nase zu groß und der Busen zu klein ist. Vor fünf Minuten war im Spiegel der Damentoilette insgesamt noch alles ziemlich okay. Und trotzdem: lieber noch mal kurz gucken. Man kann ja nie wissen …
Nicht, dass wir so etwas Grobes wie diese Nudel im Loriot- Sketch fürchten – nein, es geht eher um die ultimative Sicherheit, dass da eben keine Nudel oder Ähnliches ist! Für den Bruchteil einer Sekunde werfen wir Frauen uns mit unserem Spiegelbild einen letzten Blick zu der uns sagen soll: Komm, bleib locker … ist alles im grünen Bereich!
Und so sitzen wir also die nächsten Stunden dem Mann gegenüber, für den wir so gern schön sein möchten. Was für ein Abend! Vergessen sind Pony, Nase und andere Mängel. Hinterher zu Hause werden wir sie beim Blick in den Spiegel nicht einmal zur Kenntnis nehmen.
Aber weg können sie ja nicht sein!
Ja, und genau hier beginnt für manche das Problem: Für die einen sind die ‚Mängel’ zwar vorhanden, aber sie werden nicht von ihnen beherrscht. Sie leben in einigermaßen friedlicher Koexistenz mit ihnen und wissen, mit welchen Kniffs und Tricks sie notfalls zu kaschieren sind. Für die anderen aber sind sie ständiger Anlass, sie missmutig zu beäugen:
Der eigene Körper als Eigenheim mit sichtbaren Baumängeln …
Kein Wunder also, dass Komplimente und Liebeserklärungen nicht nur schöne Gefühle hervorrufen. Eine tief verborgene Unsicherheit weckt gewisse Zweifel an der Wahrhaftigkeit der Worte. Es fehlt ihnen einfach der Glaube, dass jemand anderes sie so lieben kann, wie sie sind. Gefangen in gnadenloser Selbstkritik ist die Palette der Gefühle dem eigenen Körper gegenüber vielfältig: sie reicht von situativer über allgemeine Unzufriedenheit bis hin zum pathologischen Selbsthass. Dabei ist es nicht die als makelhaft empfundene äußere Erscheinung, die den Selbstwert schwächt. Sie kann es gar nicht sein! Sonst müssten alle Menschen mit körperlichen Handycaps, Makeln und wie auch immer gearteten Mängeln hoffnungslos deprimiert sein und alle Makellosen müssten im Bewusstsein ihrer Schönheit vor Selbstbewusstsein sprühen!
Die Realität sieht aber anders aus: Uns begegnen Menschen, die Selbstbewusstsein und Lebensfreude ausstrahlen, obwohl sie dem allgemeinen ‚Schönheitsideal’ ganz und gar nicht entsprechen. Das Faszinierende – vielleicht sogar Beneidenswerte – an ihnen ist die authentische Art, mit der sie uns als Persönlichkeit begegnen und unsere Sympathie mühelos erobern. Gleichzeitig lassen uns Lifestyle-Magazine und TV-Reportagen permanent teilhaben an den Geschichten der ‚Reichen und Schönen’, deren Wunsch nach Optimierung ihrer äußeren Erscheinung häufig schon zu fatalen Ergebnissen geführt hat. Sie erscheinen manchmal so verfremdet, dass wir uns fragen, warum, um Himmels Willen, dieser schöne Mensch sich das angetan hat. Sichtbare, objektiv feststellbare Mängel können aus unserer Sicht nicht der Grund für einen so massiven Eingriff gewesen sein. Aber was war es dann?
Ein gesunder Selbstwert
Entscheidend für einen gesunden Selbstwert ist offenbar nicht das äußere Erscheinungsbild eines Menschen, das verletzbar und am Ende vergänglich ist. Entscheidend ist etwas, das durch eigene Geschicklichkeit, Kosmetik und eventuell durch die Chirurgie zwar unterstützt, aber nicht ersetzt werden kann: es ist das Wohlwollen, das wir uns selbst entgegenbringen! Wer sollte es denn an unserer Stelle sonst tun? Auf wen wollen wir warten, dass er uns Liebe und Wohlwollen entgegen bringt, wenn wir uns selbst nicht wertschätzen?
Der Vergleich mag trivial erscheinen, aber es drängt sich das Bild eines Verkäufers auf, der einem Kunden etwas verkaufen will, von dem er selbst nicht überzeugt ist. Je weniger er selbst von dem Produkt hält, umso mehr Worte wird er gebrauchen und umso lauter wird er es anpreisen – und resignieren, wenn der Erfolg ausbleibt. Übertragen auf den Menschen, der sich Anerkennung, Zuneigung und Liebe wünscht, heißt das: Je weniger der Mensch zu sich selbst steht, weil er von sich ‚als Produkt’ nicht überzeugt ist, umso mehr wird er meinen, um Liebe und Anerkennung kämpfen zu müssen. Und umso schmerzlicher wird er den Frust erleben, wenn seine Erwartungen nicht erfüllt werden. Mit seiner geringen Selbsteinschätzung wird er sich in solchen Momenten fatalerweise wieder einmal nur bestätigt sehen.
Diese Dynamik zu durchschauen führt natürlich noch nicht zur Lösung des Problems. ebenso wenig wird es weiterhelfen, sich mantramäßig mit „om, ich bin schön, om, ich hab’ mich lieb“ gut zuzureden. Wer aber bereit ist, nach einer Antwort auf die Frage zu suchen, warum er sich selbst eigentlich so radikal kritisch und herabsetzend betrachtet, der ist schon einen wichtigen Schritt weiter. Ist es der Anspruch, ein ganz bestimmtes Bild von sich liefern zu wollen, weil Anerkennung und Bestätigung sonst ausbleiben? Dieser Trugschluss gehört zu den existenziell besonders folgenschweren Irrtümern! Sein Ursprung liegt wahrscheinlich weit zurück und ist an dieser Stelle nicht zu klären. Es könnte sich aber lohnen, die Spur zurückzuverfolgen. Unter Umständen werden Schlüsselerlebnisse in der Erinnerung auftauchen, die die Entwicklung eines gesunden Selbstwertes einmal durchkreuzt haben. Die Folge ist möglicherweise diese belastende ständige Sorge um das eigene Aussehen und die Wirkung auf andere.
Im Wissen um die eigenen Schwachpunkte sind wahrscheinlich die wenigsten Menschen ganz frei von der Neigung, sich mit anderen zu vergleichen: Wer sich als zu dick empfindet, wird neben einer gertenschlanken Person an jedem überflüssigen Kilo dreimal so schwer tragen. Dass deren Zähne ziemlich unvorteilhaft sind, zählt in dem Moment nicht.
Wer sich schon immer volleres Haar gewünscht hat, der wird in Gegenwart einer Person, die mit einer dicken Mähne gesegnet ist, seine eigenen Haare noch dünner empfinden als sonst. Dass deren Figur eher suboptimal ist, zählt im Moment nicht. Wer ein Problem mit Falten und Fältchen hat, der wird wie gebannt jedes makellose Gesicht betrachten, das ihn in der Werbung, in Filmen und Magazinen anstrahlt. Der kritische Blick hinterher in den Spiegel bestätigt dann nur noch das, was man ja ohnehin schon vorher wusste … Dabei würden wir von all den makellosen Hochglanz-Beautys morgens beim Bäcker wahrscheinlich nicht eine einzige Person wiedererkennen. Sie sind nahezu ausnahmslos das Ergebnis professioneller Bildbearbeitung, die inzwischen alles möglich macht. Es ist also zwecklos, diesen gefakten Schönheiten nacheifern zu wollen – der Frust ist vorprogrammiert.
Also Schluss mit der Selbstsabotage!
Und wenn andere hundertmal genau das haben, was uns selbst fehlt: Denen fehlt an anderer Stelle garantiert auch etwas! Vielleicht sogar genau das, was wir selbst haben!
Der Mensch, der wir mit allen Ecken und Kanten, mit allen Stärken und Schwächen im Kern sind, ist einzigartig. Schon allein in dieser Einzigartigkeit liegt unser besonderer Wert, denn jedes Unikat besitzt die Aura des Wertvollen.
Niemandem sollten wir es gestatten, uns abzuwerten – auch uns selbst nicht!
Vor allem sollten wir uns davor hüten, uns für andere kasteien und verbiegen zu wollen, damit sie uns das geben, was wir uns selbst vorenthalten. Die eigenen, vermeintlichen Mängel gilt es zu akzeptieren, auch wenn das anfangs nur zähneknirschend gelingt. Sie machen uns schließlich zu dem unverwechselbaren Menschen, der wir sind – und der sieht gewöhnlich nun einmal nicht so aus wie Julia Roberts oder George Clooney!
Apropos…
Vor ein paar Tagen war ich mit Freunden bei meinem Lieblings-Italiener. Am Nebentisch saß eine Frau, die auf Anhieb meinen Blick fesselte. Sie hatte für mich etwas Faszinierendes, ich wusste nur nicht, wieso. Dem gängigen Schönheitsideal entsprach sie jedenfalls ganz und gar nicht. Was mochte es also sein? War es ihr Aussehen oder war es die lebendige Art, in der sie sich mit ihrem Gegenüber unterhielt? Oder war es beides? Ihr Profil zeigte ein fliehendes Kinn, eine fliehende Stirn und eine auffallend spitze Nase. Offenbar hatte sie nicht die Spur eines Problems mit ihrem Profil, denn sie schien es mit ihrer Frisur geradezu noch betonen zu wollen: Wie von einer Sturmbö waren ihre Haare straff aus dem Gesicht gefegt. Sie strahlte und flirtete, was das Zeug hielt und unterhielt sich frisch und fröhlich mit ihrem Bekannten, der ihr gut gelaunt gegenüber saß.
Während ich ihr zusah, ertappte ich mich bei dem Gedanken, welche Frisur für sie garantiert ‚vorteilhafter’ wäre: Mit Pony und Fransenfrisur müsste das, was ich als ‚Schwachstelle’ ansah, bestimmt gut zu kaschieren sein …
Tja, das war mein Ding! Aber die Frau wollte ganz offenbar gar nichts kaschieren. Im Gegenteil, sie hatte ihre ‚Ecken und Kanten’ als Teil ihrer Individualität, fast möchte ich sagen: zu ihrem Markenzeichen erklärt.
Diese Frau war nicht einfach nur gut drauf – die wusste, wer sie war!
Ob sie wohl einen Taschenspiegel bei sich hatte?
Ich kann ́s mir nicht vorstellen …..
Bis zum nächsten „Moment of Life“!
Herzlichst
Ihre Dörte Thieme